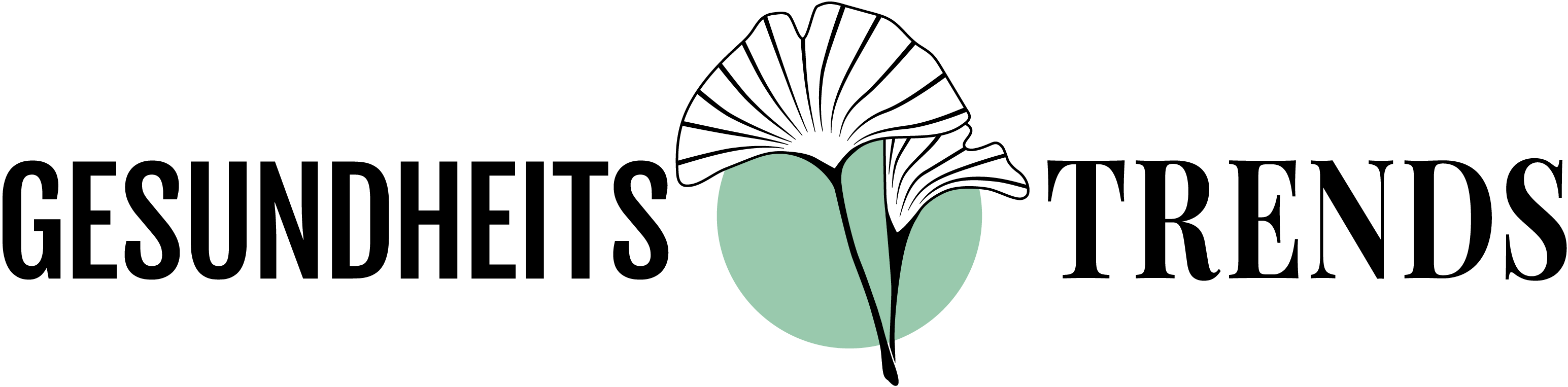Ein junger Mensch geht zur Darmkrebs-Vorsorge. Der Arzt findet tatsächlich eine verdächtige Veränderung, nimmt eine Probe, sechs Tage später ist das Ergebnis da: Krebs. Doch das eigentliche Problem folgt erst danach: Bevor eine Therapie starten kann, braucht es eine Magnetresonanztomographie (MRT). Der Patient ruft in mehreren Instituten an – und hört immer wieder dasselbe: Wartezeit acht bis zwölf Wochen. Acht bis zwölf Wochen, in denen der Tumor wächst. Acht bis zwölf Wochen, in denen die Prognose immer schlechter wird.
Österreichs Onkologie im Check
Obwohl Österreichs Krebsbehandlung im Ausland oft als sehr gut gilt, zeigt ein genauer Blick, dass es im System große Probleme gibt. Das Österreichische Onkologie Forum (ÖOF) hat deshalb in vier Workshops gemeinsam mit Ärzt:innen, Pflegekräften und Patient:innen die Situation genauer untersucht. Dabei wurden 50 Punkte überprüft – von der Vorsorge über die Diagnose bis hin zur Therapie und Nachsorge.
Ein System am Anschlag
Dass die Zahl der Krebsbehandlungen in den letzten Jahren explodiert ist, zeigt sich in den nackten Zahlen: Zwischen 2017 und 2025 kommt es zu einem Plus von 46 % an Spitalskontakten mit Therapie. „Das System ist enorm hoch belastet. Bereits 2017 hatten wir schon genug zu tun. Und wenn Sie sich vorstellen können: 46 % Steigerung – das ist natürlich nicht wenig. Aber wir haben weniger Ressourcen pro Patient“, so Dr.in Kathrin Strasser-Weippl, medizinische Leiterin der OeGHO.
Die Ärztin macht klar: So kann es nicht weitergehen. Denn während Therapien und Medikamente immer moderner werden, hängt die Basis – die Diagnostik – gefährlich hinterher. „Einige Verfahren bekommt man noch zeitnah, vor allem wenn es nicht so kritisch ist. Aber bei der Magnetresonanztomographie gibt es Engpässe – und das ist kritisch“, sagt sie.
Lebensgefährliche Wartezeiten
Das Beispiel des jungen Darmkrebspatienten ist kein Einzelfall. Viele Menschen erleben, dass sie nach einer beunruhigenden Diagnose erst einmal in einer Warteschleife hängen. „Manche Patienten zahlen privat – für 300 Euro bekommen Sie die Untersuchung am gleichen Nachmittag. Aber das ist natürlich keine Lösung“, erklärt Strasser-Weippl.
Eine große internationale Studie hat gezeigt: Pro vier Wochen Verzögerung im Diagnose- oder Behandlungsprozess steigt die Sterblichkeit um rund zehn Prozent. „Das ist doch echt nicht akzeptabel“, betont sie.
Der Blick ins Ausland
Die gute Nachricht: Österreich muss das Rad nicht neu erfinden. Andere Länder standen vor denselben Problemen – und haben Lösungen gefunden. „Das nennt sich ‚Urgent Cancer Referral‘ – man versucht, diese Patient:innen auf eine Überholspur zu lotsen, damit sie schnell die notwendige Abklärung und Behandlung bekommen“, erklärt Strasser-Weippl am Beispiel Großbritannien.
In Dänemark wird noch differenzierter vorgegangen. Dort berechnet man die Wahrscheinlichkeit, dass jemand tatsächlich Krebs hat, und ordnet die Betroffenen unterschiedlichen Versorgungspfaden zu. „In Dänemark ist es gelungen, über alle Krebsformen die Drei-Jahres-Überlebensrate von 45 auf 54 % zu erhöhen“, erklärt Dr. Thomas Czypionka, Leiter der Forschungsgruppe Gesundheitsökonomie und -politik.
Auch in Polen und Spanien hat man bewiesen, dass es funktioniert – und zwar ohne zusätzliche Geräte oder Personal. „Allein durch kluge Organisation konnte die Wartezeit bis zur Diagnose halbiert werden“, erläutert die Onkologin Strasser-Weippl.
Österreich braucht einen Fast Track
Das ÖOF fordert deshalb klar: Auch Österreich braucht ein Instrument der „onkologischen Dringlichkeit“. Ein Fast-Track-System, das sicherstellt, dass Menschen mit Krebsverdacht schnellstmöglich untersucht werden.
Doch einfach ist das nicht. Österreichs föderales Gesundheitssystem ist komplex, viele Ebenen müssen mitspielen: Länder, Spitäler, Sozialversicherung, niedergelassene Ärzt:innen.
Trotzdem zeigt sich das Forum optimistisch. „Ich bin überzeugt, dass es uns auch hier gelingen wird. Ein Schlüssel ist ein multilaterales Gespräch mit den jeweiligen Entscheidungsträgern“, betont Dr. Ewald Wöll, Präsident der OeGHO.
Der menschliche Faktor
Besonders eindringlich wird die Diskussion, wenn es um den Druck geht, den Patient:innen spüren. „Natürlich weiß man als Patient: Man braucht es schnell. Aber das erzeugt einen unheimlichen Druck“, betont Strasser-Weippl.
Viele fühlen sich in der Bürokratie verloren. Manche Krankenhäuser bieten deshalb sogenannte Lotsen an – Menschen, die Patient:innen durch die Termine und Untersuchungen begleiten.
„Man muss aber dazu sagen, dass jemand, der eine:n Patient:in an der Hand nimmt und einen Termin ausmacht, keine pflegerische Ausbildung braucht. Wir haben sehr knappe pflegerische Ressourcen. Aber ja, es braucht diese Lotsen“, erläutert sie.
Und jetzt?
Am Ende der Pressekonferenz ist die zentrale Empfehlung eindeutig: Österreich braucht ein System, das onkologische Dringlichkeit anerkennt und Patient:innen schneller zur richtigen Diagnose und Therapie bringt.
Die Bilder bleiben hängen: Der junge Patient, der monatelang auf sein MRT warten soll. Die Ärzt:innen, die verzweifelt telefonieren, um einen Einschub-Termin zu ergattern. Die Statistik, die zeigt, dass schon wenige Wochen Verzögerung über Leben und Tod entscheiden können.
„Es geht darum, Patienten rasch in die bestmögliche Therapie zu bringen, die wir in Österreich sehr gut und flächendeckend anbieten können“, fasst Wöll zusammen.
Bildquellen
- Krebsdiagnostik am Limit: iStockphoto.com/ OcusFocus