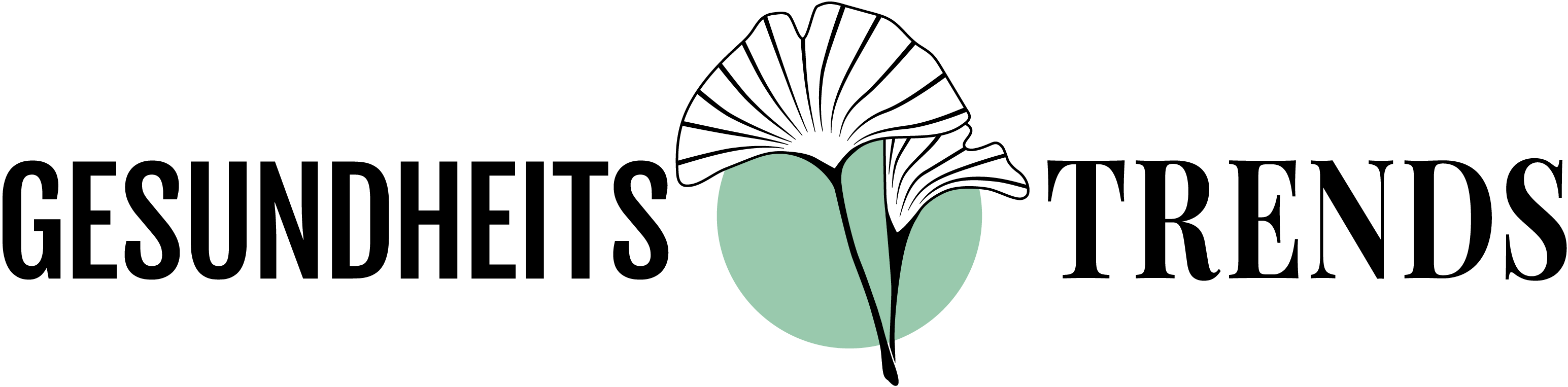Angst. Dieses kleine, unscheinbare Wort, das in der Lage ist, Herzklopfen, schwitzende Hände und Fluchtgedanken auszulösen. Jeder Mensch kennt sie – doch nicht jeder erlebt sie gleich. Während die einen bei einem Horrorfilm entspannt Chips knabbern, verkriechen sich andere schon beim ersten Spannungsmoment hinter dem Sofakissen. Manche steigen lässig in ein Flugzeug, andere geraten schon beim Check-in in Panik. Aber warum ist das so? Warum haben manche Menschen einfach mehr Angst als andere?
Ein Überlebensinstinkt aus der Urzeit
Bevor wir Angst verteufeln, sollten wir uns daran erinnern, dass sie uns am Leben hält. Angst ist ein uraltes Warnsystem, das uns vor Gefahren schützt. Schon unsere Vorfahren auf der Savanne verdankten ihr Überleben der Fähigkeit, Angst zu empfinden. Ein Rascheln im Gebüsch? Lieber einmal zu oft weglaufen, als vom Säbelzahntiger überrascht zu werden.
Im Gehirn sitzt das Angstzentrum in der Amygdala, einer mandelförmigen Struktur tief im limbischen System. Sie funktioniert wie ein Frühwarnsystem: Sie bewertet blitzschnell, ob etwas gefährlich sein könnte, und löst gegebenenfalls Alarm aus – noch bevor wir überhaupt bewusst darüber nachdenken.
Diese uralte Reaktionskette war über Jahrtausende hinweg überlebensnotwendig. Heute reagiert dieselbe Amygdala aber nicht mehr nur auf Raubtiere, sondern auch auf E-Mails vom Chef oder Chefin, Präsentationen vor Kolleg:innen oder piepsende Handys mitten in der Nacht. Kurz: Das System ist geblieben – die Bedrohungen haben sich geändert.
Gene, Hormone und ein empfindliches Nervensystem
Ein entscheidender Faktor dafür, wie stark wir Angst empfinden, steckt tief in uns: unsere Gene. Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass bestimmte genetische Varianten mit erhöhter Ängstlichkeit oder einer Neigung zu Angststörungen zusammenhängen.
Zum Beispiel beeinflusst das Serotonin-Transporter-Gen (5-HTTLPR), wie effizient unser Gehirn mit dem Glücksbotenstoff Serotonin umgeht. Menschen mit einer bestimmten Variante dieses Gens reagieren empfindlicher auf stressreiche Situationen – sie haben also biologisch gesehen ein „sensibleres“ Nervensystem.
Auch das Stresshormon Cortisol spielt eine wichtige Rolle. Manche Menschen schütten bei Bedrohung mehr Cortisol aus als andere – ihr Körper reagiert intensiver, sie geraten schneller in Alarmzustand. Manche Nervensysteme sind eben etwas „nervöser“ verdrahtet als andere.
Dennoch, Gene sind keine Einbahnstraße. Sie beeinflussen zwar, wie anfällig wir für Angst sind, doch sie bestimmen es nicht zu 100 Prozent. Umwelt, Erziehung und Lebenserfahrungen können die Aktivität dieser Gene verändern – ein Phänomen, das die Wissenschaft Epigenetik nennt.
Spuren der Kindheit
Ein schreckhafter Mensch wird nicht geboren, sondern geprägt. Unsere frühen Erfahrungen haben einen enormen Einfluss darauf, wie wir später mit Angst umgehen. Kinder, die in einem sicheren, stabilen Umfeld aufwachsen, lernen meist, dass die Welt berechenbar ist. Ihr Gehirn verknüpft Stress mit lösbaren Problemen, nicht mit Panik.
Ganz anders sieht es bei Kindern aus, die häufig Angst, Unsicherheit oder sogar Missbrauch erleben. Ihr Nervensystem lernt, ständig auf der Hut zu sein. Sie entwickeln ein „Hypervigilanz“-Muster – eine ständige innere Alarmbereitschaft. Später im Leben reicht dann oft schon ein kleiner Auslöser, um diese alte Alarmanlage schrillen zu lassen.
Auch die Eltern spielen eine große Rolle: Kinder lernen durch Nachahmung. Wenn Mutter oder Vater ängstlich auf bestimmte Situationen reagieren – etwa auf Hunde, Gewitter oder Fremde –, übernehmen viele Kinder unbewusst dieselben Reaktionsmuster. Angst kann sich also nicht nur genetisch, sondern auch verhaltensmäßig vererben.
@mentohood What happens to a person when they go through a trauma? Lets learn about anticipatory anxiety. #relatable #mentahealth #psychology #healingjourney #emotions #echomind #selfawareness #trauma #anxiety #anticipatoryanxiety ♬ realization – FutureVille
Zwischen Vorsicht und Wagemut
Jeder Mensch bringt ein individuelles Temperament mit auf die Welt. Manche Babys sind von Natur aus neugierig und furchtlos, andere reagieren empfindlicher auf Reize. Diese Unterschiede bleiben oft bis ins Erwachsenenalter bestehen. Psycholog:innen sprechen hier vom sogenannten Neurotizismus – einer der „Big Five“-Persönlichkeitsdimensionen. Menschen mit einem hohen Neurotizismuswert neigen dazu, Bedrohungen stärker wahrzunehmen und intensiver zu erleben.
Doch es gibt auch den Gegenspieler: Sensation Seeker, also Menschen, die aktiv nach Nervenkitzel suchen. Sie haben eine niedrige Grundangst und brauchen mehr Reize, um sich lebendig zu fühlen – daher der Hang zu Extremsport, Horrorfilmen oder riskanten Entscheidungen.
Beide Pole haben ihre Berechtigung: Der Ängstliche achtet auf Sicherheit, der Furchtlose sorgt für Fortschritt. Evolutionär betrachtet war es für Gruppen überlebenswichtig, beides zu haben – die vorsichtigen Planer und die mutigen Entdecker.
Was passiert, wenn Angst ausbleibt?
Es gibt tatsächlich Menschen, die fast keine Angst kennen – und das ist nicht immer ein Segen. Eine berühmte neurologische Patientin, bekannt unter dem Kürzel SM, leidet an einer seltenen Erkrankung, die ihre Amygdala zerstört hat. Sie empfindet keine Furcht, selbst in objektiv gefährlichen Situationen nicht. Einmal wurde sie mit einem Messer bedroht – und reagierte mit Neugier statt mit Panik.
Das zeigt: Angst ist überlebenswichtig. Ohne sie fehlt uns der innere Kompass, der uns vor Gefahr schützt. Zu viel Angst lähmt – zu wenig Angst gefährdet.
Dauerstress und die überreizte Seele
Dauerstress, Informationsflut, Leistungsdruck – all das stimuliert das Angstsystem permanent. Das Problem: Die Amygdala unterscheidet nicht zwischen einem brüllenden Löwen und einer brüllenden Deadline. Das Ergebnis? Chronischer Stress, Überforderung, Schlafprobleme – und ein Nervensystem, das irgendwann auf Dauerfeuer steht.
Interessanterweise reagieren nicht alle Menschen gleich auf diesen modernen Stress. Manche entwickeln Angststörungen oder Panikattacken, während andere gelassen bleiben. Hier zeigt sich erneut das Zusammenspiel von Biologie, Erfahrung und Persönlichkeit: Wer ein sensibles Nervensystem hat und in einer stressreichen Umgebung lebt, ist schlicht stärker gefährdet.
Wie Angst gelernt wird
Angst ist nicht nur individuell, sondern auch kulturell geprägt. In westlichen Gesellschaften, die Selbstverwirklichung und Erfolg betonen, wird Angst oft als Schwäche wahrgenommen. Man soll funktionieren, nicht fürchten. Das führt dazu, dass viele Menschen ihre Ängste unterdrücken – bis sie sich irgendwann in körperlichen Symptomen zeigen.
In anderen Kulturen wird Angst dagegen als natürlicher Teil des Lebens akzeptiert oder sogar spirituell gedeutet. In Japan etwa gilt es als tugendhaft, vorsichtig und zurückhaltend zu sein. In Lateinamerika wird Angst oft offener thematisiert und emotionaler verarbeitet. Unsere kulturellen Werte beeinflussen also, wie wir Angst erleben und ausdrücken.
Was hilft gegen übermäßige Angst?
Die gute Nachricht: Angst lässt sich beeinflussen. Das Gehirn ist plastisch – es kann neue Verknüpfungen bilden, alte Muster überschreiben und lernen, Bedrohungen anders zu bewerten. Hier einige der wirksamsten Strategien:
Konfrontation statt Vermeidung: Wer sich seiner Angst stellt, schwächt sie. In der Psychologie nennt man das „Exposition“. Unser Gehirn lernt: „Das ist gar nicht so gefährlich, wie ich dachte.“
- Achtsamkeit und Meditation: Studien zeigen, dass regelmäßige Achtsamkeitspraxis die Aktivität der Amygdala senken und die emotionale Kontrolle verbessern kann.
- Sport: Bewegung baut Stresshormone ab und stärkt das Selbstvertrauen – beides natürliche Gegenspieler der Angst.
- Therapie: Besonders die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) gilt als Goldstandard. Sie hilft, verzerrte Gedankenmuster zu erkennen und zu verändern.
- Gemeinschaft: Angst schrumpft in Gesellschaft. Freunde, Familie oder Selbsthilfegruppen bieten Halt und korrigieren die oft übertriebene Wahrnehmung von Gefahr.
@robmulder88 Overcome Fear #overcomefear #overcomeyourfear #socialanxiety #selfimprovement #overcomefears ♬ original sound – Rob Mulder
Die positive Seite der Furcht
So paradox es klingt: Angst ist nicht unser Feind. Sie schützt uns, sie mahnt uns zur Vorsicht, sie lehrt uns Demut. Ohne Angst gäbe es keine Tapferkeit, denn Mut entsteht nur, wenn man sich der Angst stellt und trotzdem weitergeht.
Viele große Leistungen der Menschheit – von der Raumfahrt bis zur Heilung schwerer Krankheiten – waren nur möglich, weil Menschen gelernt haben, ihre Angst zu zähmen, ohne sie zu verdrängen. Angst zu fühlen bedeutet also auch, lebendig zu sein. Wer sie spürt, ist wach, aufmerksam und verbunden mit dem, was zählt: dem eigenen Überleben – und manchmal auch dem eigenen Wachstum.
Bildquellen
- Genetik und Angst: iStockphoto.com/ PeopleImages