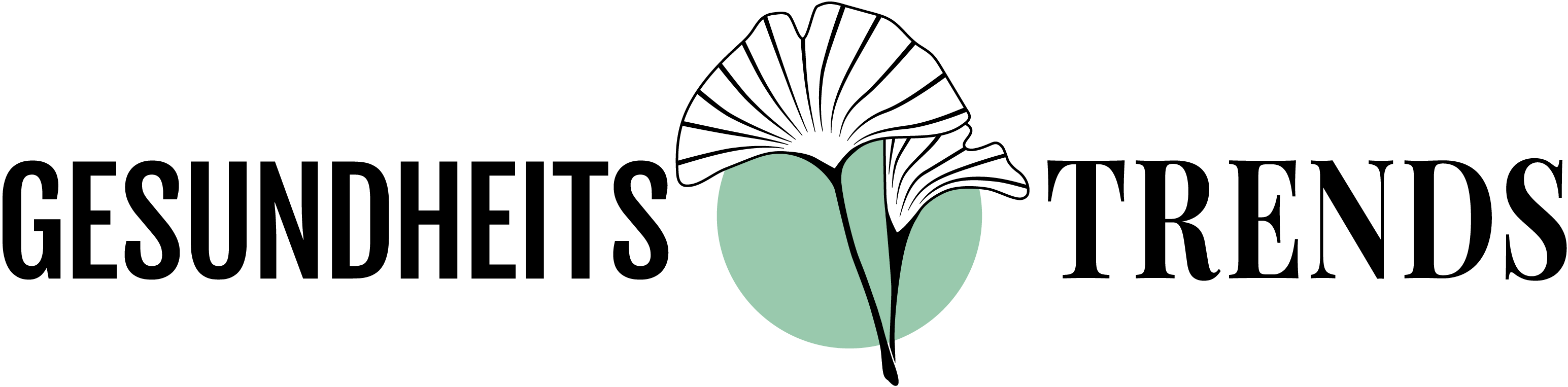TikTok ist aus dem Alltag von Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. Was als unterhaltsame Kurzvideo-Plattform begann, hat sich für viele zu einem ständigen Begleiter entwickelt – bis hin zu einem problematischen Nutzungsverhalten, das weit über „ein bisschen Zeitvertreib“ hinausgeht.
Viele Eltern, Pädagogen und Fachleute warnen schon lange vor den Risiken, die mit exzessiver Nutzung einhergehen: von Konzentrationsproblemen über Schlafstörungen bis hin zu echten Suchtmechanismen.
Wir haben mit Florian Buschmann, Gründer der Initiative OFFLINE HELDEN, gesprochen. Er arbeitet seit Jahren im Bereich Medienkompetenz und Mediensuchtprävention, hat über 50.000 junge Menschen erreicht und zeigt Wege auf, wie Jugendliche heute wirklich geschützt werden können.
TikTok im Fokus: Was bedeutet die Bestätigung durch die EU wirklich?
Vor einigen Monaten veröffentlichte die Europäische Kommission eine offizielle Bewertung, in der das Suchtpotenzial von TikTok bestätigt wurde. Für viele Betroffene und Fachleute war dies kein überraschender Schritt, sondern ein längst überfälliger Meilenstein. Buschmann sieht darin vor allem Anerkennung für ein Thema, das in der Praxis lange unterschätzt wurde:
„Ja, das bestätigt vieles, was wir seit Jahren in der Praxis sehen. Für mich ist es wichtig, dass das Thema endlich nicht mehr als ‚Einzelfallproblem‘ abgetan wird, sondern als strukturelles Risiko.“
Damit bringt er auf den Punkt, was viele fürchten: Die Probleme gehen über vereinzelte Fälle hinaus und sind systemisch – sie sind eine direkte Folge der Funktionsweise sozialer Medien. Die EU-Kommission kritisiert insbesondere Funktionen wie endloses Scrollen (Infinite Scroll) und Autoplay, die Nutzer immer länger an die Plattform binden – unabhängig davon, ob sie das bewusst möchten oder nicht.
Doch warum ist das relevant? Weil diese Mechanismen direkt an neurobiologische Belohnungsschleifen im Gehirn andocken. Die Folge: Nutzer:innen scrollen weiter, obwohl sie eigentlich aufhören wollen. Dieses unendliche „Immer-noch-ein-Video“-Prinzip minimiert natürliche Stopp-Punkte und macht es extrem schwer, den Konsum eigenständig zu begrenzen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Wie TikTok süchtig macht – Die Mechanismen hinter dem Bildschirm
Bei TikTok und ähnlichen Plattformen läuft vieles nach einem einfachen, aber hochwirksamen Prinzip ab: der Wechsel zwischen Erwartung und Belohnung. Jedes neue Video ist eine neue Chance auf Überraschung, Unterhaltung oder emotionalen Reiz – und genau diese Unvorhersehbarkeit aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn.
Buschmann beschreibt dies so:
„Endloses Scrollen und Autoplay nehmen dir die Entscheidung ab. Es gibt keinen natürlichen ‚Stopp-Punkt‘. Das Gehirn bleibt im Belohnungsmodus – und rutscht schneller in Autopilot statt in bewusste Selbststeuerung.“
Gerade bei Jugendlichen ist das kritisch: Die kognitiven Fähigkeiten zur Selbstkontrolle und Selbstregulation entwickeln sich erst zwischen 20 und 25 Jahren vollständig – also weit nach dem Jugendalter. Das bedeutet, dass Kinder und Jugendliche besonders anfällig für solche digitalen Belohnungsschleifen sind, weil sie schlichtweg noch nicht über die notwendigen inneren Steuerungsmechanismen verfügen.
Was also wie harmloser Zeitvertreib aussieht, kann sich schnell zu einem Muster aus kontrollverlustartigem Nutzungsverhalten entwickeln – ganz unabhängig davon, ob die Betroffenen selbst „süchtig sein wollen“ oder nicht.
Frühwarnzeichen erkennen: Wenn Nutzung zum Problem wird
Nicht jede Nutzung von TikTok ist automatisch problematisch – doch es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass ein ungesunder Umgang vorliegt. Buschmann benennt typische Entwicklungen, die er bei Kindern und Jugendlichen immer wieder beobachtet:
„Ich sehe vor allem: immer weniger Frustrationstoleranz, mehr Reizbarkeit, Schlafprobleme, Konzentrationsabfall – und eine starke Verschiebung von echten Beziehungen hin zu Dauer-Reizen. Viele wirken innerlich unruhig, auch wenn das Handy gerade nicht in der Hand ist.“
Diese Symptome sind kein Zufall. Dauerhafte Nutzung führt zu einer Art Reizüberflutung, bei der das Gehirn ständig auf der Suche nach neuen Stimuli ist. Langsamere, weniger aufregende Aktivitäten – wie Hausaufgaben machen, Gespräche führen oder einfach nur entspannen – wirken im Vergleich plötzlich langweilig und mühsam.
Daher ist es wichtig, solche Signale frühzeitig zu erkennen, bevor sich die Nutzung verfestigt und zu echten Problemen in Schule, Familie und persönlichem Wohlbefinden führt.
Von Nutzung zu Sucht: Wo liegt die Grenze?
Ein zentraler Punkt im Diskurs um Social-Media-Sucht ist die Frage: Wann ist Nutzung noch normal und wann schon Sucht?
Buschmann bringt es klar auf den Punkt:
„Sucht kennzeichnet sich durch einen Kontrollverlust. Aktivitäten mit Freunden, Schule und Verpflichtungen geraten in den Hintergrund. Oftmals reagieren Betroffene schnell gereizt, wenn man sie auf diese Themen anspricht. Vorsicht gilt vor Nachsicht. Ein kritisches oder krankhaftes Verhalten wieder in richtige Bahnen zu lenken, kostet mehr Kraft, als von Anfang an die Weichen richtig zu stellen.“
Dieser Kontrollverlust ist das entscheidende Kriterium. Es geht nicht allein um die Zeit, die jemand auf TikTok verbringt – sondern darum, welche Auswirkungen diese Zeit auf das restliche Leben hat. Wenn Schule, Freundschaften, Schlaf oder Hobbys dauerhaft leiden, dann spricht man von einem ernsthaften Problem.
Hinzu kommt: Buschmann berichtet von Jugendlichen, die über 40 Stunden pro Woche auf sozialen Medien unterwegs sind. „40+ Stunden pro Woche bedeuten oft: weniger Schlaf, weniger Lernen, mehr Konflikte zuhause, höhere emotionale Instabilität. Viele rutschen in Erschöpfung, Antriebslosigkeit oder Angst – und die Schule wird zur Dauer-Baustelle.“
Das ist keine Übertreibung, sondern eine Entwicklung, die sich bundesweit in vielen Praxen, Beratungsstellen und Schulen zeigt – und die auch durch wissenschaftliche Studien bestätigt wird.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Warum reine Verbote nicht ausreichen
Ein häufiger Vorschlag im politischen Diskurs sind harte Altersgrenzen oder Verbote. Australien und Frankreich beispielsweise setzen auf klare Regeln, um Minderjährige stärker zu schützen. Klingt auf den ersten Blick sinnvoll – doch laut Buschmann greift dieser Ansatz zu kurz.
„Wir alle kennen den Spruch: ‚Verbote machen attraktiver‘ und das ist bei Social Media auch so. Alkohol wird trotz Verbot konsumiert. Neben klaren Richtlinien, welche auch Verbote sein können, sollten wir nie vergessen, dass nur Aufklärung nachhaltig schützt. Wir müssen die Menschen hinter dem Verhalten mental stärken, um oberflächliche Regulation zu vermeiden.“
Ohne begleitende Maßnahmen wie Aufklärung, Prävention oder Unterstützungssysteme verpuffen Verbote oft wirkungslos oder werden sogar hintergangen. Jugendliche finden Wege, Zugang zu bekommen – sei es über Freunde, alternative Geräte oder neue Accounts.
Das zeigt: Regulierung allein ist eine zu schwache Antwort auf ein tief verwurzeltes, psychologisch fundiertes Phänomen.
Wie echte Regulierung aussehen kann
Wenn nicht Verbote, was dann? Buschmann liefert eine differenzierte Antwort:
„In unseren Workshops zur Prävention von Mediensucht erleben wir Kinder, die Lust auf das Leben haben. Oftmals sind diese jedoch emotional belastet. Wenn wir nur am Medienverhalten ansetzen, sind wir wie ein Gärtner, der das Unkraut auf zwei Dritteln abschneidet und sich wundert, warum es in zwei Wochen stärker zurück ist. Gleichzeitig müssen wir ein Verständnis dafür schaffen, wie diese Plattformen süchtig machen. Mit diesem Bewusstsein kann man bereits anders agieren. Es ist also wichtig, an den Ursachen zu agieren und nicht nur oberflächlich.“
Das bedeutet: Prävention muss ganzheitlich gedacht werden. Es reicht nicht, den Konsum einzuschränken, ohne die Gründe hinter dem Verhalten zu adressieren. Viele Jugendliche nutzen Social Media nicht nur zur Unterhaltung, sondern als Ablenkung, als Bewältigungsstrategie oder als Ersatz für echte soziale Begegnungen.
Eine funktionierende Strategie umfasst daher:
- Medienbildung über Jahre, nicht als einmalige Schulveranstaltung.
- Emotionale Unterstützung in Familie und Schule.
- Stärkung von Selbststeuerung und Frustrationstoleranz.
- Engmaschige Begleitung statt reiner Kontrolle.
Regulierung muss also mit psychologischer und pädagogischer Arbeit verknüpft werden – sonst bleibt sie bloße Symbolpolitik.
Datenschutz: Die zweite Front der TikTok-Debatte
Neben der Suchtproblematik gewinnt ein weiterer Aspekt zunehmend an Bedeutung: Datenschutz und Überwachung. TikTok geht offenbar bei der Sammlung von Daten immer aggressiver vor – und das betrifft nicht nur die Inhalte, die Nutzer:innen selbst posten.
Ein gemeinsamer Test von BBC und Sicherheitsexperten hat ergeben, dass Daten abgesaugt werden, auch wenn die App nicht geöffnet ist. In einigen Fällen wurden sogar Informationen über Krebsdiagnosen, Fruchtbarkeit oder psychische Krisen an TikTok übermittelt, ohne dass die Nutzer:innen bewusst etwas geteilt hatten – was die BBC als „Überwachungsimperium“ bezeichnet.
Grund dafür sind modifizierte Tracking-Technologien wie der sogenannte TikTok-Pixel. Dieses gängige Tracking-Tool überwacht das Online-Verhalten der Nutzer und sendet Informationen zurück an TikTok – und zwar nicht nur innerhalb der App, sondern auch außerhalb, wenn Webseiten besucht werden.
Diese Entwicklung zeigt: Die Risiken von TikTok gehen über Sucht hinaus – sie betreffen Privatsphäre, Sicherheit und Autonomie jedes Einzelnen.
Es gibt jedoch Schutzmaßnahmen: Datensparsame Browser und Browsererweiterungen wie AdBlock Plus oder uBlock Origin können Tracking-Pixel blockieren und so die Datenerfassung einschränken.
Bildquellen
- TikTok Sucht bei Teenagern: urbazon/ istockphoto.com