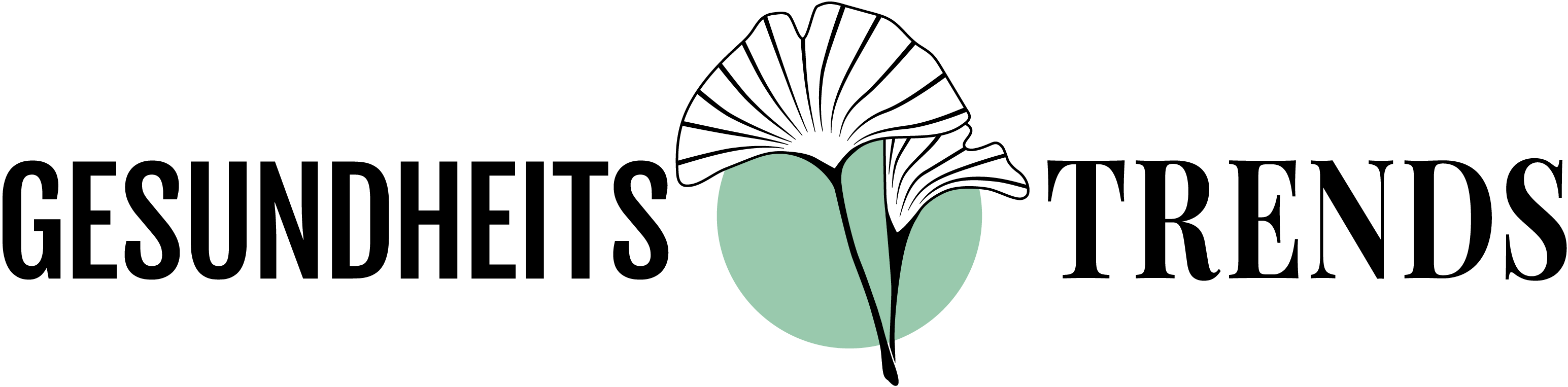Wenn sich die Nächte verlängern, Kürbisse geschnitzt werden und die Streaming-Plattformen von Horrorfilmen dominiert werden, scheint die Lust am Gruseln ihren jährlichen Höhepunkt zu erreichen. Millionen Menschen weltweit suchen im beziehungsweise Ende Oktober bewusst den Nervenkitzel – sie lassen sich erschrecken, erschauern und dennoch am Ende erleichtert aufatmen.
Doch was genau macht den Reiz des Schreckens aus? Warum suchen wir Erlebnisse, die eigentlich mit Gefahr, Schmerz und Angst verbunden sind? Und was passiert dabei in unserem Körper?
Die Psychologie der Angstlust
Die Anziehungskraft des Horrors ist kein Zufallsprodukt, sondern tief im menschlichen Verhalten verankert. Angst ist eines der ursprünglichsten Gefühle – ein Warnsignal, das seit der Evolution das Überleben sichert. Dennoch haben wir gelernt, diese Emotion auch bewusst aufzusuchen, wenn sie in einem sicheren Rahmen stattfindet.
Das zentrale Prinzip, das die Freude am Horrorfilm möglich macht, ist also der sogenannte „Protective Frame“ – ein Schutzrahmen, der uns erlaubt, Bedrohung zu erleben, ohne real gefährdet zu sein. Wir wissen: Das, was wir sehen, ist Fiktion. Der Serienkiller, das Monster, das plötzliche Knarren in der Dunkelheit – all das geschieht auf der Leinwand, nicht im eigenen Zuhause. Diese Gewissheit schafft emotionale Distanz und gibt uns das Gefühl von Kontrolle. Der Mensch kann somit eine intensive Emotion erleben, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen.
Sensation Seeking – Die Suche nach dem Kick
Psycholog:innen sprechen beim Hang zu intensiven Erlebnissen vom sogenannten Sensation Seeking. Menschen mit dieser Persönlichkeitsausprägung neigen dazu, starke emotionale oder körperliche Reize zu suchen – etwa Geschwindigkeit, Gefahr oder eben Angst.
Horrorfilme bieten einen legalen, risikoarmen Weg, diese Stimuli zu erfahren. Das Gehirn reagiert auf die Szenen wie auf reale Bedrohung – aber der Verstand weiß, dass keine Gefahr besteht. Dieses Wechselspiel erzeugt ein besonders intensives, „aufregendes“ Gefühlserlebnis.
Außerdem hinaus erfüllen Horrorfilme eine psychologische Trainingsfunktion. Sie bieten eine sichere Simulation von Bedrohungssituationen. Das Gehirn übt gewissermaßen, mit Stress, Angst und Ungewissheit umzugehen. Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Horrorfilme sehen, in realen Krisen gelassener reagieren können, weil sie gelernt haben, Angstsituationen kontrolliert zu erleben und zu überwinden. Die Fiktion wird zur psychischen Probe.
Was im Körper passiert: Die Biochemie der Angst
Auch wenn wir wissen, dass das Grauen auf dem Bildschirm nicht real ist, reagiert unser Körper erstaunlich stark. Das Gehirn unterscheidet nur bedingt zwischen tatsächlicher und inszenierter Bedrohung. Das erklärt, warum Horrorfilme echte körperliche Symptome wie Gänsehaut, erhöhten Puls oder kalte Hände hervorrufen können.
Sobald ein Schreckmoment naht – ein plötzlicher Schnitt, eine bedrohliche Musiksequenz, ein unerwarteter Schatten – aktiviert das Gehirn das sympathische Nervensystem. Dieses leitet die klassische „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion ein:
- Der Herzschlag beschleunigt sich.
- Die Atmung wird flacher und schneller.
- Muskeln spannen sich an, um auf eine mögliche Bedrohung vorbereitet zu sein.
- Die Pupillen weiten sich, die Aufmerksamkeit fokussiert sich.
Diese Reaktion läuft über die Amygdala, das Angstzentrum im Gehirn, und beeinflusst auch den Hypothalamus, der hormonelle Stressreaktionen steuert.
Die wichtigsten Hormone im Spiel
- Adrenalin und Noradrenalin: Sie werden in Sekundenbruchteilen freigesetzt und sorgen für die bekannten körperlichen Symptome der Erregung. Herzfrequenz, Blutdruck und Energieverbrauch steigen.
- Cortisol: Dieses Hormon folgt in der zweiten Phase der Stressreaktion. Es hält die erhöhte Wachsamkeit aufrecht und unterstützt kurzfristig Konzentration und Leistungsfähigkeit.
- Dopamin: Sobald die bedrohliche Szene vorüber ist, setzt das Belohnungssystem ein. Der Körper erlebt Erleichterung, Triumph und Freude – ausgelöst durch Dopamin. Das erklärt, warum wir nach einem Schreck oft lachen müssen oder euphorisch wirken.
- Endorphine: Sie wirken schmerzhemmend und beruhigend. Nach einem intensiven Angstmoment sorgen sie für Entspannung und Wohlgefühl – ähnlich wie nach sportlicher Anstrengung.
- Oxytocin: Wird Horror gemeinsam erlebt – etwa im Kino oder mit Freunden – kann durch das gemeinsame Erschrecken Bindung entstehen. Oxytocin, das „Kuschelhormon“, stärkt soziale Nähe und Vertrauen.
@artiex.ai You can’t escape the scary nun #valak #theconjuring #klingai #aicontent ♬ Creepy and simple horror background music(1070744) – howlingindicator
Angst als „positiver Stress“: Eustress vs Distress
Diese körperlichen Vorgänge entsprechen einem kurzen, aber intensiven Eustress – also positivem Stress. Während chronischer Stress schädlich ist, kann kurzzeitige, kontrollierte Erregung den Kreislauf anregen, die Durchblutung fördern und sogar die Ausschüttung immunstärkender Substanzen unterstützen.
In diesem Sinne kann das kontrollierte Gruseln eine Art „Mini-Training“ für den Körper darstellen – eine kurzfristige Herausforderung, auf die anschließend Entspannung folgt.
Aus gesundheitlicher Sicht ist Angst ein zweischneidiges Phänomen. Sie kann schädlich sein, wenn sie dauerhaft anhält oder übermäßig stark erlebt wird. In der richtigen Dosis jedoch kann sie stimulierend und sogar wohltuend wirken.
- Kurzfristige Effekte
Während eines Horrorfilms steigen Puls und Blutdruck an, der Stoffwechsel beschleunigt sich – in manchen Studien wurde ein erhöhter Kalorienverbrauch gemessen, vergleichbar mit leichtem Ausdauertraining. Nach dem Film fällt der Körper in eine Entspannungsphase, die mit Endorphinausschüttung und Wohlgefühl einhergeht.
Diese rhythmische Abfolge von Anspannung und Erleichterung wirkt ähnlich wie eine emotionale „Sauna“: Erst Hitze, dann Abkühlung – und am Ende ein Gefühl von Reinigung und Ruhe.
- Langfristige Effekte und Resilienz
Langfristig kann das wiederholte Erleben kontrollierter Angst die Resilienz fördern. Menschen, die gelernt haben, sich ihren Ängsten in sicherem Kontext zu stellen, entwickeln häufig mehr Selbstvertrauen im Umgang mit Stress. Sie erfahren: Angst ist unangenehm, aber sie vergeht.
Aus gesundheitspsychologischer Perspektive handelt es sich um einen Mechanismus der Exposition – eine sanfte Form der Konfrontationstherapie, die auch in der Psychotherapie zur Behandlung von Angststörungen verwendet wird.
- Grenzen und Risiken
Natürlich hat der Horrorfilm seine Grenzen. Menschen mit starken Angstneigungen, Schlafstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder posttraumatischen Belastungen sollten auf intensive Horrorinhalte verzichten.
Wird der Schutzrahmen – also das Wissen, dass man sicher ist – nicht aufrechterhalten, kann das Erleben kippen: Der Film löst dann echten Stress statt lustvollem Nervenkitzel aus. In solchen Fällen überwiegt die Belastung, nicht der Reiz.
Die soziale Komponente: Angst verbindet
Interessanterweise wird das gemeinsame Gruseln häufig als angenehmer empfunden als das alleinige. Hier spielt die soziale Dimension eine wesentliche Rolle. Die Emotionen sind ansteckend – das gilt auch für Angst. Wenn wir uns in einer Gruppe erschrecken, spiegeln wir unbewusst die Reaktionen der anderen. Gleichzeitig erzeugt das gemeinsame Erleben ein Gefühl von Nähe und Zusammenhalt.
Aus neurobiologischer Sicht verstärkt dieses Miteinander die Ausschüttung von Oxytocin, was wiederum Stress reduziert und Vertrauen fördert. Deshalb werden gemeinsame Filmnächte oft als „bindend“ und befreiend empfunden.
Halloween selbst erfüllt eine ähnliche Funktion: Es bietet eine gesellschaftlich akzeptierte Möglichkeit, sich mit Angst, Dunkelheit und Tod auseinanderzusetzen – Themen, die im Alltag häufig verdrängt werden. In dieser ritualisierten Form wird Angst nicht nur erträglich, sondern sogar lustvoll. Sie wird Teil einer kulturellen Praxis, die Sicherheit, Gemeinschaft und Selbstwirksamkeit betont.
Das moderne Bedürfnis nach Intensität: Angst als bewusstes Erlebnis
Die Faszination des Horrors ist komplex und zutiefst menschlich. Sie vereint biologische Reaktionen, psychologische Mechanismen und kulturelle Bedeutungen.
Horrorfilme sind nicht bloß Unterhaltung – sie sind eine Form des emotionalen Trainings, eine bewusste Auseinandersetzung mit einem Gefühl, das sonst oft verdrängt wird.
Aus evolutionsbiologischer Sicht war Angst überlebensnotwendig. Sie schärfte die Sinne, mobilisierte Energie und bewahrte unsere Vorfahren vor Gefahren. Heute erfüllt sie eine andere Funktion: Sie erlaubt uns, Gefahr zu simulieren und damit zu verstehen, ohne sie tatsächlich erleben zu müssen.
Das erklärt, warum insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene Horrorfilme schätzen – in dieser Lebensphase wird der Umgang mit Angst, Risiko und Autonomie intensiv geübt.
Wer also in der Halloween-Nacht bewusst zum Horrorfilm greift, sucht nicht nur Spannung, sondern auch Selbstwirksamkeit: das Gefühl, eine Bedrohung auszuhalten und sie zu überwinden. Der Körper reagiert, der Geist reflektiert, und am Ende steht ein kurzer Triumph über die eigenen Instinkte.
Bildquellen
- Halloween-Grusel: Carlos Pascual/ iStockphoto.com