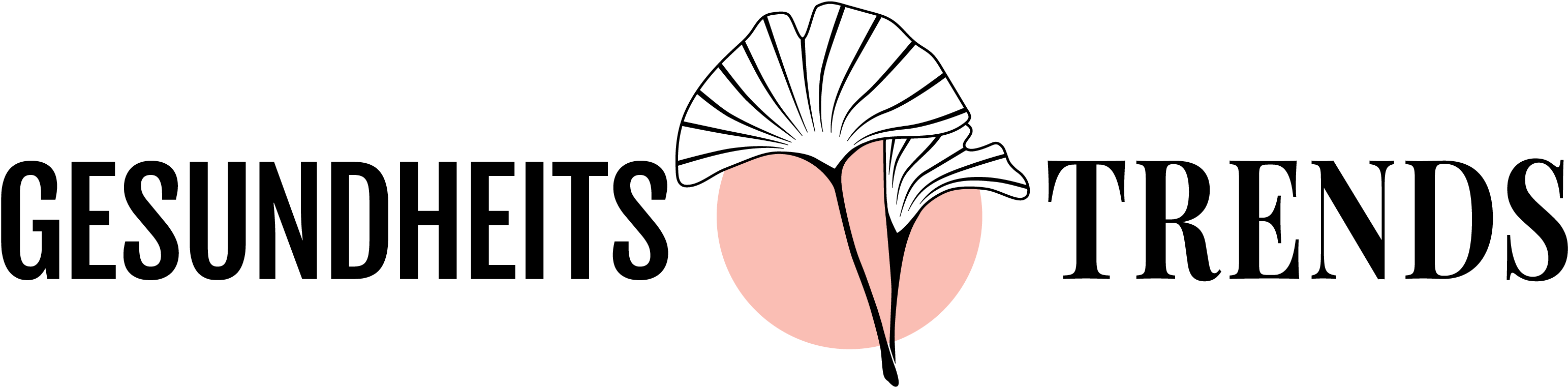75 Prozent vom „Baby Blues“ betroffen
Die Ankunft eines Babys ist ein Wendepunkt im Leben einer Frau, doch nicht immer sind die ersten Tage nach der Geburt von überschwänglicher Freude geprägt. Viele junge Mütter erleben nach der Geburt den so genannten Baby-Blues, eine vorübergehende Phase der Niedergeschlagenheit, Überforderung und Depression. Laut einem Bericht der Stadt Wien ist der „Baby Blues“ die häufigste und leichteste Form der Wochenbettreaktion und tritt bei rund 75 Prozent der Frauen auf. Sie leiden unter plötzlichen Weinkrämpfen und Angstzuständen. Diese emotionale Achterbahnfahrt, ausgelöst durch Hormonschwankungen, Schlafmangel und die Anpassung an die neue Lebenssituation, klingt in der Regel innerhalb weniger Tage wieder ab. Bleiben die Symptome jedoch bestehen oder verschlimmern sich, kann es sich um eine Wochenbettdepression handeln, eine ernsthafte psychische Erkrankung, die 10 bis 15 Prozent der Mütter betrifft.
Unterschiede erkennen
Die Unterscheidung zwischen dem vorübergehenden Baby Blues und der Wochenbettdepression ist grundsätzlich wichtig: Während der Baby Blues meist nur von kurzer Dauer ist (max. 1 Woche), zeichnet sich die Wochenbettdepression durch anhaltende Symptome wie tiefe Niedergeschlagenheit, Schlafstörungen, starke Selbstzweifel und das Gefühl, das eigene Baby nicht lieben zu können, aus. Bei solchen Anzeichen sollte man nicht zögern, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine frühzeitige Behandlung kann entscheidend für eine erfolgreiche Bewältigung der Erkrankung sein.
Mut ist entscheidend
Es ist wichtig zu betonen, dass sowohl Baby Blues als auch Wochenbettdepressionen häufig auftreten und dass es viele Hilfsangebote gibt. Trotzdem fällt es vielen Müttern mit einer postpartalen Depression nicht leicht, über ihre Beschwerden und Sorgen zu sprechen. Dabei spielt auch die gesellschaftliche Erwartung eines Glücksgefühls nach der Geburt eine Rolle. Dabei ist es ganz natürlich, dass Menschen unterschiedliche Gefühle haben – auch nach der Geburt. Und jeder Mensch kann einmal von einer psychischen Krise oder Erkrankung betroffen sein. Man sollte wenn möglich am besten offen mit seiner Hebamme, seiner Ärztin oder seinem Arzt über seine Gefühle sprechen. Sie können beraten und helfen, die nächsten Schritte zu planen. Auch Selbsthilfegruppen und spezialisierte Psychologinnen und Psychologen können eine wichtige Hilfe sein. Und immer daran denken: Man muss nicht perfekt sein und es ist in Ordnung, sich Hilfe zu holen, um sich an die neue Rolle zu gewöhnen.
Kostenübernahme der Therapie
Laut Gesundheit.gv.at werden alle notwendigen und zweckmäßigen diagnostischen und therapeutischen Maßnahme von den zuständigen Sozialversicherungsträger übernommen. Für bestimmte Leistungen kann jedoch ein Selbstbehalt oder Kostenbeitrag erhoben werden. Nähere Informationen bekommt man bei den jeweiligen Sozialversicherungsträger.
Vorbeugung und Behandlung
Zur Vorbeugung kann es hilfreich sein, bereits während der Schwangerschaft über das Risiko einer Wochenbettdepression informiert zu werden und Pläne für die Zeit nach der Geburt zu machen. Sollte sich eine postpartale Depression entwickeln, stehen verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter Psychotherapie und, wenn nötig, Medikamente. Eine postpartale Depression ist behandelbar, und mit der richtigen Unterstützung können Mütter sich vollständig erholen und eine gesunde Beziehung zu ihrem Kind aufbauen.